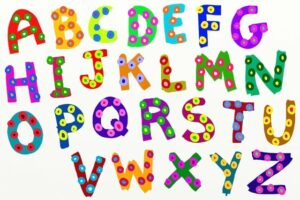Sehr geehrte Damen und Herren
Ich habe einmal gelernt, dass es keine Doppel-Umlaute gibt und dass z. B. der Plural von «Saal» «Säle» geschrieben wird oder dass der Diminutiv von «Boot» «Bötchen» geschrieben wird.
Eben habe ich auf der Homepage des schweizerischen Fernsehens das Wörtchen «Böötli» gelesen. Da die Endung für die Rechtschreibung keine Rolle spielen dürfte, habe ich mich gefragt, ob es im Schriftdeutschen in der Schweiz Doppel-Umlaute gibt, denn reine Mundart, wo eigene Regeln gelten dürften, ist der Diminutiv ja nicht. Würden Sie die Schreibweise «Sääle» empfehlen?
I. F.
24.6.2025
Sehr geehrter Herr I. F.
Es ist zu unterscheiden zwischen Standarddeutsch, Schweizer Standarddeutsch (Schriftdeutsch, Hochdeutsch) und Schweizerdeutsch (Dialekt).
Im Standarddeutschen ist die Regel eindeutig und so, wie Sie es gelernt haben:
Es gibt (aus ästhetischen Gründen) keine Doppel-Umlaute. Der Doppelvokal «aa» wird im Plural von Saal zum einfachen Umlaut «ä»: Saal → Säle, die Doppelvokale «aa» und «oo» im Diminutiv zu den einfachen Umlauten «ä» bzw. «ö»: Paar → Pärchen, Boot → Bötchen.
Saal ist übrigens das einzige Wort mit «aa», das einen Umlautplural bildet, alle andern bilden den Plural mit einer Endung: Aal, Haar, Paar, Maas, Maat, Saat, Staat, Waage.
Da es keine Doppel-Umlaute gibt, ist die Form mit einem «ä» korrekt. Die SOK empfiehlt deshalb nicht die Schreibweise *Sääle.
Im Schweizer Standarddeutschen wird Säli in Plural und Diminutiv wie im Standarddeutschen mit einem «ä» geschrieben: Säli. Das Wort hat wie andere Schweizer Diminutive, viele Esswaren bezeichnend, Eingang in den Duden und ins Standarddeutsche gefunden: Flädli, Guetzli, Guetsli, Güggeli (mdal.), Hörnli, Knöpfli, Müsli (schweiz. Müesli), Nüsslisalat, Peterli (mdal.), Pflümli (mdal.), Plätzli (mdal.), Rippli, Rüebli, Säli, Schlüttli (mdal.), Spätzli, Springerli, Stöckli, Wädli, Weggli, Wienerli, Zeltli. *Bötli jedoch nicht.
Bemerkenswert ist Müesli, wo die mundartliche Aussprache berücksichtigt wird.
Für die Frage der Deklination in Genitiv und Plural wird bei den meisten auf den Kasten «Götti» verwiesen, wo es heisst: «Schweizer Substantive mit der Endung -(l)i, die Eingang in den deutschen Wortschatz gefunden haben, können im Genitiv und manchmal sogar im Plural die Endung -s erhalten: des Götti[s], die Götti[s], überwiegend so: «des Müslis, die Müslis», entsprechend also: des Säli[s], die Säli[s].
Die Endung «-li» spielt für die Rechtschreibung insoweit eine Rolle, als sie das Wort dem Schweizer Standarddeutschen oder dem Schweizerdeutschen zuweist. Im Standarddeutschen erfolgt die Diminuierung mit dem Umlaut oder den Endungen «-chen» (Kindchen), «-lein» (Tischein), «-le» (Häusle), «-el» (Kindel) und «-i» (Mutti).
Im Schweizerdeutschen (Dialekt) gibt es keine offzielle, verbindliche Orthographie. Sehr anerkannt ist jedoch die Dieth-Schreibung: Eugen Dieth: Schwyzertütschi Dialäktschrift. Verlag Sauerländer, Aarau 1938, 2. Aufl. 1986, ISBN 3-7941-2832-X.
Hauptmerkmal der Dieth-Schreibung ist neben der Unterscheidung zwischen kurzen, sanften (Lenes) und langen, starken Konsonanten (Fortes) die konsequente Unterscheidung zwischen kurzen und langen Vokalen, die ausschliesslich durch Doppelschreibung (Ausnahme: «y» für den geschlossenen «i»-Laut) gekennzeichnet werden, also: Leerer, Glaas, schöön.
Für Berndeutsch ist die Bärndütschi Schrybwys üblich, die sich stärker am standarddeutschen Schriftbild orientiert: Werner Marti: Bärndütschi Schrybwys. Francke, Bern 1972; 2. Aufl. 1985, ISBN 3-305-00074-0. Hier werden die Vokallängen wie im Standarddeutschen geschrieben, also: Lehrer, Glas, schön.
Die bei der Diminuierung im Standarddeutschen übliche Verkürzung der Doppelvokale «aa» und «oo» zu den einfachen Umlauten «ä» bzw. «ö» gibt es in beiden Werken nicht, geschrieben wird also im Schweizerdeutschen: Böötli, Sääli. Darauf ist die Schreibweise im SRF zurückzuführen, ein Einsprengsel von Schweizerdeutsch im sonst standarddeutschen Text.
Peter Müller, SOK